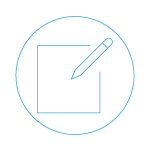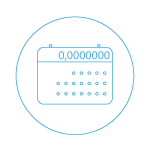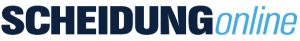Prozeßkostenhilfe bei Scheidung online
Auch wenn Sie die Kosten eines Scheidungsverfahrens (Prozeßkostenhilfe bei Scheidung online) nicht selbst bezahlen können, soll nach dem Willen des Gesetzgebers die Möglichkeit zur Scheidung gegeben sein. Es besteht in diesen Fällen die Möglichkeit, Prozeßkostenhilfe bzw. Verfahrenskostenhilfe zu beantragen. Falls dies vom Amtsgericht bewilligt wird, muß man keine Gerichtskosten und keine Anwaltsgebühren bezahlen.
Auch wenn Sie über kein Einkommen oder nur über ein geringes Einkommen verfügen, bearbeiten unsere Fachanwälte Ihre Scheidung und beantragen für Sie Prozeßkostenhilfe beim Amtsgericht.
Wenn Sie wissen möchten, ob es sinnvoll ist, für Sie Prozeßkostenhilfe zu beantragen, können Sie unsere Fachanwälte anrufen (0234-964 844 0) und wir besprechen dies gerne telefonisch mit Ihnen. Das Telefonat löst keine Anwaltsgebühren aus.
Wer erhält vom Gericht Prozeßkostenhilfe ?
Prozeßkostenhilfe bzw. Verfahrenskostenhilfe erhält man in der Regel bei
- keinem Einkommen
- geringem Einkommen
- Hartz IV Bezug
- ALG I oder ALG II Bezug
- hohen Schulden
In diesen Fällen beantragen wir für Sie Prozeßkostenhilfe bzw. Verfahrenskostenhilfe. Sofern das Gericht dem Antrag auf Bewilligung von Prozeßkostenhilfe bzw. Verfahrenskostenhilfe stattgibt, werden Ihre Anwaltsgebühren und Gerichtskosten vom Staat übernommen. In den meisten Fällen können Sie selbst überprüfen, ob in Ihrem Fall die Voraussetzungen zur Bewilligung von Prozeßkostenhilfe bzw. Verfahrenskostenhilfe gegeben sind (Link zum Herunterladen des Formulars zur Berechnung, dieses befindet sich unter „downloads“).
Darüber hinaus erhält man Prozeßkostenhilfe nur, wenn das Verfahren Aussicht auf Erfolg hat. Das bedeutet, die Voraussetzungen für eine Ehescheidung müssen gegeben sein. Das bedeutet, die Eheleute müssen bei Einreichung der Scheidung mindestens 10 Monate lang getrennt gelebt haben. Eine Trennung ist auch innerhalb einer Wohnung oder innerhalb eines Hauses möglich. Einzelheiten zu den Voraussetzungen einer Ehescheidung finden Sie hier !
Wie beantragt man Prozeßkostenhilfe ?
Wenn Sie Prozeßkostenhilfe beantragen möchten, muss ein entsprechendes Formular – die sogenannte Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse – ausgefüllt und dem Gericht eingereicht werden.
Dieses Formular finden Sie hier (Link zum Formular, Antrag Prozeßkostenhilfe oder unter „downloads).
Ihre Angaben in diesem Formular müssen belegt werden durch Bescheinigungen in Kopie. Erforderlich sind
- aktuelle Lohnabrechnung (falls Sie Lohn erhalten)
- Hartz IV Bescheid (falls Sie Hartz IV beziehen)
- ALG I oder ALG II Bescheid (falls Sie ALG I oder ALG II erhalten)
- Ihr Mietvertrag in Kopie (falls Sie Miete bezahlen)
- Ihr aktueller Kontoauszug in Kopie zum Nachweis über die Höhe des Kontostandes
- Nachweise über Verbindlichkeiten bzw. Kreditraten, z.B. Kontoauszug mit Abbuchung einer Kreditrate
Wann wird keine Prozeßkostenhilfe vom Gericht bewilligt ?
Das Gericht bewilligt keine Prozeßkostenhilfe, wenn größeres Vermögen vorhanden ist. Wer Ersparnisse von mehr als 5.000,00 Euro hat, erhält keine Prozeßkostenhilfe. Wer Eigentümer oder Miteigentümer einer Immobilie ist, erhält möglicherweise keine Prozeßkostenhilfe. In diesen Fällen muss die Immobilie verkauft werden oder mit Schulden belastet werden und von diesem Geld müssen die Scheidungskosten bezahlt werden. Sofern allerdings die Immobilie vollständig mit Schulden belastet ist, kann Prozeßkostenhilfe bewilligt werden,ob wohl man Eigentümer einer Immobilie ist.
Beispiel:
Frau Müller ist zu 1/2 Eigentümerin einer Eigentumswohnung, die einen Wert in Höhe von 100.000,00 Euro hat. Auf der Wohnung lasten Schulden in Höhe von 100.000,00 Euro, für die Frau Müller haftet. In diesem Fall würde ein Verkauf der Wohnung voraussichtlich der Frau Müller kein Geld bringen, da der Verkaufspreis vollständig an die Bank gezahlt werden müßte. Daher kann in diesem Fall Prozeßkostenhilfe bewilligt werden, obwohl Frau Müller Eigentümerin einer Immobilie ist.
Wenn der Ehegatte gut verdient, bewilligt das Gericht in der Regel keine Prozeßkostenhilfe. In diesem Fall kann ein Anspruch gegen den Ehegatten bestehen auf Bezahlung von Verfahrenskostenvorschuss. Dieser anspruch ist ein Teil des Anspruchs auf Trennungsunterhalt. Das heißt, der Ehegatte muss unter Umständen die Scheidungskosten tragen.
Beispiel:
Die Ehefrau hat ein Einkommen in Höhe von 750,00 Euro monatlich und möchte die Scheidung beantragen und Prozeßkostenhilfe beantragen. Der Ehemann verdient monatlich netto 3.500,00 Euro und muss davon auch keinen Kindesunterhalt oder größere Kreditraten bezahlen. In diesem Fall wird das Gericht voraussichtlich der Ehefrau keine Prozeßkostenhilfe bewilligen, da die Ehefrau einen Anspruch gegen den Ehemann auf Bezahlung von Prozeßkostenvorschuss haben könnte.
Wann muss die Prozeßkostenhilfe zurück gezahlt werden ?
Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, dem Gericht eine Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu melden. Unabhängig davon schreibt das Gericht in den ersten vier Jahren nach Abschluß des Scheidungsverfahrens die Mandanten an, denen Prozeßkostenhilfe bewilligt wurde. Diese Mandanten müssen dann erneut eine Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse geben. Sofern sich diese verbessert haben, muss die Prozeßkostenhilfe, ggf. auch in Raten unter Umständen zurück gezahlt werden.
Beispiel:
Frau Müller erhält für das Scheidungsverfahren Prozeßkostenhilfe, da sie nur über ein monatliches Einkommen in Höhe von 750,00 Euro monatlich verfügt. Ein Jahr nach Abschluß des Scheidungsverfahrens erhält sie Post vom Amtsgericht und muss dort Auskunft geben, wie sich ihre finanzielle Situation entwickelt hat. Sie hat inzwischen eine andere Anstellung gefunden und verdient monatlich jetzt 1,500,00 Euro. Das Amtsgericht fordert sie daher auf, die gewährte Prozeßkostenhilfe in Raten zurück zu zahlen.